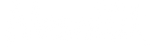Quelle: "© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv, Erstveröffentlichung 20.07.2025, von Marco Dettweiler (Text), Lucas Bäuml (Fotos)
Muster mit Wert
Sobald ein Klingenblatt Muster hat, weiß nicht nur der Kenner: Das ist Damaststahl. Doch wie wird so ein Messer hergestellt?
Damastmesser fallen auf. Ihr Klingenblatt hat ein kontrastreiches Muster, das aus vielen Wellen besteht, die sich parallel zur Schneide verteilen. Manche Exemplare haben sogar Kringel oder andere Strukturen. Doch wie kommt der Damaszenerstahl, wie er auch genannt wird, zu seinem Muster? Wir machten uns auf den Weg zu einer Schmiede, um uns den Prozess genau anzuschauen. Dafür muss man sich nicht ins Flugzeug setzen und nach Japan fliegen. Es genügt eine Autofahrt nach Solingen zu Nesmuk. Die Manufaktur hat sich auf hochwertige Messer mit besonderen Stählen spezialisiert
Die Esse wird auf 1100 °C erhitzt
Alle Damastmesser des Hauses gehen durch die Hände von Markus Pattschull und Torsten Schreier. Sie sind Nesmuks Schmiede. Pattschull ist der Lehrer von Schreier. Die Ausbildung des Schülers dauert einige Jahre. Die in der unteren Etage des Gebäudes liegende Schmiede sieht so aus, wie man es sich vorstellt: dunkel, staubig, unaufgeräumt und mit einer gelbrot glühenden Esse in der Mitte. Markus Pattschull sieht überhaupt nicht aus, wie man es sich vorstellt. Er ist von dürrer, sehniger Gestalt, hat die Haare zu einem Zopf gebunden. Eigentlich hätte sich der Diplom-Biologe in der Forschung mit Ribonukleinsäure beschäftigen können, nun steht er mit dunkel getönter Schutzbrille vor dem Amboss und hämmert gekonnt und kräftig auf ein Stück Stahl. Mit diesem 350 × 200 × 150 Millimeter großen Block beginnt seine Arbeit. Er besteht aus 220 oder 330 dünnen, verschweißten Lagen Stahl. Die Art der Stähle, die Anzahl der Lagen und deren Bearbeitung mit dem Hammer und anderen Werkzeugen sind das Geheimnis eines jeden Damastmessers.
Damastschmied Markus Pattschull
bei der Arbeit
Dass Markus Pattschull nicht ganz von vorn beginnen muss und gleich mit diesem Paket starten kann, macht sein Leben als Schmied etwas leichter. Nesmuk lässt die Pakete in einem Stahlwerk anfertigen, auch weil dabei im Vergleich zur manuellen Produktion kein Material verloren geht. Dort drückt ein Manipulator, eine Riesenpresse, mehrere Hundert Lagen aufeinander und feuerverschweißt sie bei 1100 Grad Celsius. Bei jedem Damaszenerstahl müssen mindestens zwei Sorten Stahl alternierend übereinanderliegen. Erst dadurch kann später ein kontrastreiches Muster auf dem Klingenblatt entstehen. Nesmuk verwendet drei unterschiedliche Stähle. Der Stahl mit hohem Nickelanteil lässt später das Klingenblatt glänzen und ist flexibler als die beiden anderen Stähle. Nesmuk verwendet dafür die Sorte mit der Klassifikation 1.2419.05. Diese eher seltene Sonderlegierung hat einen Anteil von 1,3 Prozent Kohlenstoff und die gleiche Menge Wolfram. Unter den Metallen hat sie den höchsten Schmelzpunkt, ist weiß glänzend und mit dem Härtegrad 65 (gemessen nach Rockwell-Verfahren in der Skala C) ziemlich hart.
Die Faszination von Damastmessern lebt auch davon,
dass die Hersteller für die Muster mancher Exemplare mehrere Tausend Lagen einsetzen.
So bietet Nesmuk etwa eines an mit 28.718. Um dort hinzukommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die ursprüngliche Methode ist das Falten. Allerdings nutzen sie die Schmiede nicht, um möglichst viele Lagen zu bekommen, sondern um den Stahl zu raffinieren, also zu reinigen und zu veredeln. Bei diesem Verfahren legt der Schmied das Paket, das er zuvor auf etwa 1100 Grad Celsius erhitzt hat, quer auf einen Keil und hämmert solange oben darauf, bis es in der Mitte so dünn wird, dass er es an der Kante des Ambosses umklappen kann, um die beiden Hälften aufeinanderlegen zu können. Weil in der Mitte immer die gleiche Stahlsorte aufeinandertrifft, summieren sich die Lagen etwa so: 5, 9, 17 . . . 257, 515, 1029. Die andere Methode ist das Stapeln: Der Schmied nimmt einen Block mit zehn feuerverschweißten Lagen, schneidet ihn etwa in fünf gleich große Stücke, um diese wiederum zu verschweißen, und hat dann fünfzig Lagen gestapelt. Das Ganze noch einmal, und er ist bei 250. Dieses Verfahren ist schneller, weil der Schmied im Vergleich zum Falten die Anzahl der Feuerverschweißungen halbiert.
Doch Markus Pattschull ist an Rekorden im Lagenschichten nicht interessiert. Er will ein kreatives Muster erzeugen. Dafür verschweißt er immer mehrere Blöcke miteinander. Jedes einzelne Lagenpaket ist meist schon mit einer oder mehreren Methoden bearbeitet. Der Schmied hat eine große Auswahl, um immer nur eines zu tun: die anfangs gleichmäßig übereinanderliegenden Stahlschichten aus der Ordnung zu bringen. Wer früher mit Knetmasse gespielt hat, kann es sich besser vorstellen. Stapelt man zum Beispiel drei schwarze und drei weiße rechteckige Platten übereinander und drückt oben auf eine Stelle, verschieben sich die Schichten darunter. Nun kann man den Block in die Hände nehmen und das jeweilige Ende mit der linken und rechten Hand in unterschiedliche Richtungen drehen. Oder man stellt den Block auf eine der Längskanten und haut mit der Hand von oben darauf. Alle diese Möglichkeiten der Verformung hat der Schmied mit dem Hammer ebenfalls. Nur dass die Lagen aufgrund der Hitze untrennbar miteinander verbunden sind.
Am Ende dieser Verformungen hat der Schmied ein flaches, rechteckiges Stück Stahl vor sich, das aus gewundenen und verschobenen Lagen besteht, aus dem noch die endgültige Messerform getrennt werden muss. Für die Unikate der C150-Serie macht Markus Pattschul aus einem Stück ein Messer. Dazu hämmert er es auf dem Ambos in die endgültige Form. Die Klinge wird ausgeschmiedet, der Erl wird eingekerbt, Schrägen entstehen. Für andere Serien, die nicht ganz so aufwendige Mosaikmuster haben, weil Pattschul weniger Deformationstechniken eingesetzt hat, wird das Lagendamast in größeren Stücken hergestellt, sodass gleich mehrere Messer daraus entstehen können. So lässt Nesmuk für die Serien C90 und C100 bei einem Spezialisten in Solingen immer zwei oder vier Messer aus einer Damaszenerstahlplatte mit dem Laser schneiden. Sie wird dafür auf fünf Millimeter ausgewalzt, gehärtet und schrumpft durch die Abnahme der Oxidschicht dann auf vier Millimeter.
Für jedes Messer gilt: Bevor der Feinschliff folgt, muss jede Klinge gehärtet werden. Dazu erhitzt es der Schmied auf 800 Grad Celsius, damit sich die Kristallstruktur ändert, um es direkt danach schnell abzukühlen und im weiteren Schritt anzulassen, also noch einmal auf circa 200 Grad Celsius zu erwärmen.
Der Clou kommt zum Schluss
Bis jetzt ist das Damastmesser nur in seiner Form fertig, das Muster ist nur zu erahnen, Kontraste sind kaum vorhanden, der Unterschied zu einem Messer aus Monostahl ist gering. Und dann taucht Markus Pattschul das Messer in ein Bad aus Eisen(III)-chlorid-Lösung. Die Säure macht sich über den Stahl her, sie reagiert mit der Oberfläche. Da er unterschiedlich zusammengesetzt ist, greift die Säure den einen Stahl mehr an als den anderen. Die Säure reagiert weniger stark mit dem Nickel, also der weichen Lage, sodass er die silberglänzende Erscheinung behält. Auf die anderen Stähle wirkt die Lösung mehr ein, sie werden dunkler. Wie in einem Zaubertrick erscheint auf dem Klingenblatt nach dem Säurebad ein komplexes Muster.
Damit Kontraste und Grautöne über Jahre hinweg genauso rein bleiben, hat Nesmuk zusammen mit Wissenschaftlern des Fraunhofer Instituts ein Verfahren entwickelt, welches das Klingenblatt vor Oxidation schützt. Die Stähle wären wegen ihres Kohlenstoffanteils anfällig dafür. Weil das Klingenblatt nicht rostfrei ist, bildet sich ohne diesen Schutz mindestens eine Patina, was nicht mehr so hübsch aussieht. Doch eine Legierung mit Chrom, die nicht rostet, ist keine Alternative, weil solche Stähle eine geringere Schneidleistung haben. Nesmuk will Messer mit einer maximalen Schärfe. Deswegen gibt das Unternehmen vor dem Verkauf alle Damastmesser in einer Hülle unter Vakuum zu einem Spezialisten, der sie in einer Kammer mit einer mikroskopisch dünnen Glasschicht überzieht. Das Klingenblatt ist dann vor dem Kontakt mit Sauerstoff geschützt, der Stahl reagiert nicht.
Dass Exemplare aus Damaszenerstahl trotz des ganzen Aufwandes nur schöner, aber in der Anwendung nicht schärfer sind als Monostahlmesser, zeigt Nesmuk selbst in seinem Sortiment. Schon die Modelle der "günstigen" Kollektion Soul gehören zu den schärfsten Messern, die wir kennen. Nur fallen sie nicht so auf.