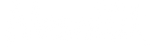Quelle: The Heritage Post Magazin, Ausgabe No. 55, von Stephanie Kobayashi (Text).
Extrem scharf
Feine helle Linien überziehen die markant geformte Klinge, verdichten sich und bilden Knotenpunkte. Sie bilden eine Struktur, ein Geflecht, das kaum vergleichbar ist und gerade deshalb so fasziniert – denn jede Linie, ob hell oder dunkel, begann als ein Stück Stahl. Das Muster ist dabei keineswegs zufällig entstanden, sondern das Ergebnis der künstlerischen Vorstellungskraft und der jahrzehntelangen Erfahrung des Damastschmieds. Durch die über 2.500 Jahre alte Technik des Feuerverschweißens schuf er das Unikat U40 – ein Kochmesser von Nesmuk mit 24.577 Lagen Stahl.
Aber ist das Kunst oder kann man damit noch schneiden?
Den Messern von Nesmuk eilt ein besonderer Ruf voraus: Extrem scharf sollen sie sein und extrem teuer. Doch wer sich intensiver mit den Messern mit der Fledermaus beschäftigt, stellt schnell fest, dass teuer relativ ist und die Schärfe das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit. Vor allem aber, dass es selbst bei einem so archaischen und über die Jahrtausende bewährten Werkzeug wie einem Messer noch immer materielle und technische Innovationen gibt, die die Herzen von Sterne-Köchen und Messer-Nerds
schneller schlagen lassen.
Für schlappe 8.000 Euro ist das Unikats-Messer zwar ein
teures Werkzeug, aber es kommt nahezu mit den gleichen
Schneideigenschaften daher wie ein „normales“ C150 Messer von Nesmuk: Die schmale und rasiermesserscharfe
Klinge gleitet ohne Kraftaufwand durch das Schnittgut, welches sich durch die geschliffene Facette ebenso leicht löst.
Mit 65 HRC ist es extrem hart, aber durch die besondere Zusammensetzung der Kohlenstoffstähle eben nicht spröde. Notiz am Rande: Die C150 Serie ist zwar die exklusivste Variante der EXKLUSIV-Serie, unterscheidet sich zu den günstigsten Nesmuk Messern der Serien soul und janus ab 450 Euro für ein Kochmesser) kaum wahrnehmbar bezüglich ihrer Schneidfähigkeit. Der große Preisunterschied entsteht also vor allem durch das Handwerk und die verwendeten Materialien.
„Wir tun materialseitig alles,
um die schärfsten Messer der Welt zu machen“
...erklärt Stephan Borchert, Geschäftsführer und seit einem Jahr Miteigentümer von Nesmuk. Vor 15 Jahren kam Stephan als eine Art Praktikant in die 2008 gegründete kleine Schmiede auf einem Bauernhof am Steinhuder Meer bei Hannover – nachdem er im Fernsehen eine Sendung über das „schärfste Messer der Welt“ gesehen hatte. Und in einem Nebensatz wurde erwähnt, dass der Schmied Unterstützung gebrauchen könnte. Der studierte Soziologe arbeitete zu der Zeit im Bundestag und war nur noch frustriert von dem realitätsfremden Politik-Zirkus. Durch die japanische Kampfkunst Aikido, mit der er während des Studiums in Kontakt kam, beschäftigte Stephan sich intensiv mit der japanischen Kultur, sog Kurosawa-Filme auf und interessierte sich natürlich auch für die Schwerter und
Messer, weshalb die Sendung auf fruchtbaren Boden fiel.
Also kontaktierte er den Schmied, fuhr gleich in der nächsten Woche zu ihm und konnte ihn schließlich durch einen Monat Arbeiten gegen Kost und Logis davon überzeugen, dass er es wirklich ernst meinte, Damast-Schmied werden zu wollen.
Was Stephan damals noch nicht wusste: Sein Lehrmeister
hatte noch zwei Gesellschafter aus einer Düsseldorfer Werbeagentur im Boot, die Nesmuk zu einer Marke machen wollten. Der Marken-Name bezieht sich auf den amerikanischen Schriftsteller und Outdoorsman George Washington Sears, der von seinem Kindheitsfreund „Nessmuk“ aus dem Stamm der Narragansett das Jagen, Fischen und Überleben lernte. Aus Dankbarkeit nutzte Sears später den Namen des jungen Ureinwohners als Pseudonym für seine Outdoorbücher und prägte damit auch einen Messertypus, mit einer sehr dünnen und markant geschwungenen Klinge. „Nessmuk bedeutet frei übersetzt Wald- oder Holz-Erpel“, ergänzt Stephan Borchert.
Die ersten Messer von Nesmuk waren vor allem für die Jagd geschmiedet, was sich in der Form der Klinge mit der runtergezogenen Spitze noch immer erkennen lässt. Schnell wurde die Marke in „Nerd-Kreisen“ bekannt, bei Jägern
und Messer-Freaks, die sich mit Metallurgie auskannten. Doch die Nische zeigte sich begrenzt und die Küche stellte sich als ein Feld mit größerem Potenzial für die Marke heraus. Nach dieser Erkenntnis bekam die Schmiede 2013 eine neue „Spielwiese“ in Solingen – mehr Platz, mehr Möglichkeiten. Stephan wurde zum Produktionsleiter ernannt, „aus Mangel an Alternativen“, scherzt er rückblickend.
Außeroderntliche Flexibilität
Nesmuk war angekommen. In Solingen, aufgrund der herausragenden Qualität in der Sternegastronomie und auch als Statussymbol in der Küche. Mit dieser Begehrlichkeit kamen jedoch auch Missverständnisse. Bei den Damaszener-Messern, die zwischen 1.300 und 5.000 Euro kosten, erwarteten manche Kunden, die von Kohlenstoffstahl keine Ahnung haben, dass sie immer scharf blieben und ihre schöne Damast Oberfläche so sein würde wie am ersten Tag. Auch die „Bequemlichkeit“ der 2010er Jahre, die Messer hervorgebracht hat, die einfach in die Spülmaschine können, habe viel von der Wertschätzung und dem Verständnis von und für gute Messer zerstört. Und es wurde dadurch auch noch eine neue Kauf-Hürde geschaffen: Manch potentieller Kunde sieht vom Kauf ab, aus der Sorge, seine Frau könnte das Messer in die Spülmaschine packen.
Was die Schärfe betrifft: Jedes Messer wird irgendwann stumpf, wenn es nicht regelmäßig gepflegt und gelegentlich nachgeschärft wird. Die Krux: Wenn Messer aus Chrom-Stahl, was als nicht rostender Edelstahl geläufiger ist, abstumpfen, brechen meistens kleine Stücke aus der Schneide heraus und durch diesen „Abrissstumpf“
mit einer kaum sichtbaren, ungewollten Zahnung schneidet ein eigentlich stumpfes Messer größtenteils noch. Bei einem Messer aus Kohlenstoffstahl und insbesondere bei einem Damast Messer ist die Struktur und die Schneide so feinkörnig, dass die Abstumpfung zwar wesentlich länger dauert, aber ziemlich homogen ist. Ganz plötzlich „rutscht“ die Klinge dann nur noch auf der Schale einer Tomate hin und her, statt sie zu schneiden.
Vor allem seitlich abrutschende Bewegungen auf dem Schneidbrett sorgen für eine schnelle Abstumpfung, weil der harte Stahl an der maximal dünnen „Schneidphase“ keinen Widerstand leisten kann. Schon früh war für Nesmuk klar: „Wir brauchen etwas Zäheres“ und mehr Flexibilität, auch an dieser Stelle. Eine dieser Lösungen lautete Niob. Ein seltenes Element, das eine einzigartige und patentiert Stahllegierung veredelt, um sie flexibler, fester und standhafter zugleich zu machen und für die Serien SOUL und JANUS verwendet wird. Die außerordentliche Flexibilität zeigt sich eindrücklich bei dem „Slicer“, dem Filetiermesser von Nesmuk. Es lässt sich biegen wie ein dünnes Blech und findet von selbst in seine perfekt gerade Form zurück – ohne Schaden zu nehmen. Seitliches Schieben und Verkanten sollte aber trotzdem immer und bei allen Messern vermieden werden.
Einziger Nachteil des Niob-Stahls: Er läuft mit der Zeit an. Also wurde für die Serie Janus schon 2010 eine eigene mikrometerstarke Beschichtung unter dem Namen „Diamond-Like-Carbon“ entwickelt, bei der sich Kohlenstoff-Ionen auf atomarer Ebene auf dem Stahl verkrallen. Diese schwarze Beschichtung macht das Messer unempfindlich gegen Säuren und Basen und hat eine enorme Kratzfestigkeit. „Natürlich haben wir auch probiert, ein maximal geschärftes Messer zu beschichten“, erzählt Stephan Borchert, doch die 2 Mü waren doch relevant für die Schärfe, weshalb die Klinge im „V-Schliff“ an der Schneidphase unbeschichtet ist.
Aber was ist mit dem Damast?
Auch hier wurde in der Basis schon materialseitig ein Umweg genommen, um besser und schärfer zu sein. Gefertigt werden die EXKLUSIV-Messer vom Damast-Schmied in der eigenen Schmiede aus jeweils
drei hochlegierten Werkstoffstählen. Eine der Geheimzutaten ist die Beigabe von 1,3 Prozent Wolfram bei einem extra für Nesmuk hergestellten Stahl in Kombination mit der Verwendung von 1,3 Prozent Kohlenstoff im Eisen (üblich sind 0,6 %, um schon sehr scharfe Klingen zu machen).
„Mehr Kohlenstoff vergütet den Stahl“, erwähnt Stephan, wodurch er nach dem Feuerverschweißen noch feiner und
zäher wird, jedoch auch wesentlich aufwändiger weiterzuverarbeiten. Die Herausforderung: „Wie bearbeitet man kostenrational solch einen Stahl?“ Alle Prozesse brauchen mehr Zeit und Erfahrung, vom Schmieden bis zum Schärfen. Auch besondere Schleifmittel sind nötig, alleine um die Klingengeometrie und die extreme Schärfe zu erreichen.
Für die Forschung wurde und wird auch weiterhin unter anderem mit dem Max-Planck-Institut und der Fraunhofer Gesellschaft kooperiert. Vor allem bei der Fragestellung, ob es möglich ist, eine transparente Schutzschicht zu entwickeln, um die Schwachstellen von Damaszener-Stahl auszumerzen – nämlich die Rostanfälligkeit und die Abgabe von Eigengeschmack bei Kontakt mit sauren Lebensmitteln. Dreieinhalb Jahre wurde schließlich daran geforscht, bis auch hier die Lösung gefunden wurde: Eine Glasbeschichtung! Die NPC-Beschichtung, kurz für Nesmuk Protective Coating, schützt die aufwändig hergestellten Klingen unsichtbar vor allen äußeren Einflüssen, nur die Schneidphase wurde auch hier aus Schärfe-Gründen ausgespart.
Diese Entwicklung überzeugte dann auch den Damast-Schmied Markus Patschull, der sich um die handgeschmiedeten Nesmuk-Messer kümmert. Markus ist eigentlich studierter Mikrobiologe, gönnte sich nach seinem Abschluss einen Messerschmiedekurs und blieb dabei. Damast sei für ihn keine Kunst, sondern Kunsthandwerk – vor allem aber Handwerk, betont er, denn als Handwerker müsse man auf Zuruf abbilden können, was jemand von einem möchte.
EXKLUSIV C90 Kochmesser 180
EXKLUSIV C100 Kochmesser 180
EXKLUSIV C150 Kochmesser 180
Der Schmiedemeister darf sich jedoch, wenn die Serienprodukte produziert sind, in der Schmiede vollkommen austoben, für Mini-Serien oder Unikate. Während die Damast-Messer C90, C100 und C150 ein „definiertes“ Muster aus handgeschmiedetem „wilden“ Damast haben, die es zu reproduzieren gilt – wennschon trotzdem jedes Messer einzigartig ist – schöpft Markus Patschull für „freie“ Arbeiten das Potenzial der Musterbeeinflussung maximal aus und kombiniert virtuos unter anderem Mosaikdamast, Explosionsdamast und Lagendamast. Die Vision einer Klinge hat Markus Patschull dabei von Anfang an im Kopf, und schafft diese Muster durch mehrfache räumliche Neuanordnung, Brechen der Kanten, Verdrehung et cetera. Eine seiner Spezialitäten ist der „Ferry Flip“, bei dem er ein komplexes Muster im Inneren, also an der Kopfseite, durch eine Art Zusammenpuzzlen zuvor geschmiedeter Elemente erstellt und diese dann zu kleinen Schiffchen schneidet,
zusammenheftet und anschließend in Perfektion feuerverschweißt. „Der große Moment“ ist dann immer das Eintauchen der fertig geschmiedeten und geschliffenen Klinge in eine Säure, die die Kontraste der Lagen hervorbringt und das Damast-Muster sichtbar macht.
Trotz dieser hohen Wertschätzung des Handwerks geht Nesmuk mit der Zeit und sperrt sich nicht gegen Automatisierung. Die bei den Handwerkern eher ungeliebte Aufgabe des Schleifens der Griffe wird demnächst durch einen kooperativen Roboter voll automatisiert. Bei den Hölzern setzt die Manufaktur hauptsächlich auf europäische Bäume und freut sich, endlich französischen Wacholder anbieten zu können. Mooreiche und Olivenholz sind die beliebtesten Hölzer, Wüsteneisenholz das vielleicht außergewöhnlichste und wenn es nicht exklusiv genug ist, können sogar Edelsteine als Griffmaterial für die Koch-, Steak- und Klappmesser – die mit ihrer Klingenlänge in jedes Restaurant mitgenommen werden können – verarbeitet werden. Auf Tropenhölzer wird dagegen mittlerweile komplett verzichtet.
Neben der Prozessoptimierung, um Lieferengpässe zu vermeiden, wird auch gerade für die Expansion ins Ausland
einiges umgebaut – primäres Ziel ist Amerika, Sehnsuchtsziel Japan. Zunächst aber will die Marke in Kontakt mit ihren deutschen Kunden bleiben und bietet dafür regelmäßig Werksbesichtigungen und kulinarische Events an – denn die dünnen und extrem scharfen Messer muss man einfach mal in die Hand nehmen und beim Gleiten durch eine Tomate selbst erleben.